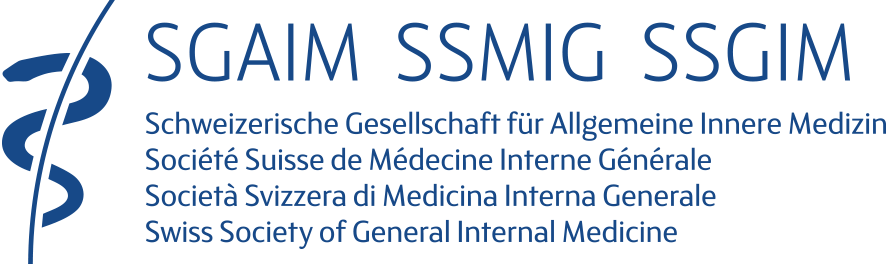16 – Optimierungen der Dokumentationsqualität
Bei DRG-Optimierungen ist das A und O die Verbesserung der Dokumentationsqualität. Wir unterstützen eine medizinisch sinnvolle und vollständige Dokumentation, wobei diese essenziell für eine hohe Behandlungsqualität und die Nachvollziehbarkeit von Behandlungsverläufen ist, und nicht primär DRG-motiviert. Präzisionen, die für die medizinische Kodierung wichtig sind, sind meist medizinisch und qualitativ relevant, weshalb sich dieser Austausch nicht primär ertragsorientierend, sondern qualitätssteigernd gestaltet werden soll.
Werden Diagnosen präzisiert, beispielsweise Diabetes mit oder ohne Entgleisung, Diagnosen mit dem korrekten Stadium versehen, Ergänzungen wie akut/chronisch, oder alle Interventionen klar aufgelistet, beispielsweise alle VAC-Wechsel, Pleura-Punktionen, Besuche von Ernährungsberatung oder Interpretationen von Labor- und Medikamentenlisten, so wird automatisch der DRG optimiert, da im Fallpauschalensystem die Abbildung von Aufwänden in der Kodierung mit dem finanziellen Aufwand gekoppelt ist und jährlich angepasst werden.
Daher sind bei DRG-Schulungen und -Optimierungen das zentrale Handlungsfeld die Dokumentationsqualität.
Wie man die Dokumentationsqualität fördern kann, wird in diesem Blog zusammengetragen. Vielleicht ergibt sich der eine oder andere Ansatzpunkt, der in Ihre Klinikstruktur passt.
Schriftliche Hilfestellungen
- DRG Checkliste mit den häufigsten relevanten Nebendiagnosen, die in der Dokumentation nicht vergessen gehen dürfen, und die spezifiziert werden sollten
- PC Streifen: häufigste DRG-relevante Informationen (analog DRG Checkliste), die zusammengefasst als PC Streifen von den Ärzten an die Monitore geklebt werden können.
- Newsletter intern: regelmässige (zB monatliche, quartalsmässige) wichtige Informationen aus der med. Kodierung, welche Punkte fokussiert werden sollten
- Newsletter SGAIM: regelmässiger Newsletter der Fachgesellschaft, um DRG-Themen in kleinen Dosen zu lernen und zu vertiefen
- Textbausteine: mit der Kodierung überarbeitete Textbausteine, mit der man Diagnosen oder Prozedurenteile dokumentiert, inklusive DRG-relevanter Details, die so nicht vergessen werden
- Behandlungspfade: in Zusammenarbeit mit den Kodierern können Behandlungspfade und optimale Liegedauern, die direkt bei Eintritt generiert werden, erarbeitet werden (Optimierung Behandlungseffizienz und Liegedauer) // AVOS
- Interne Kodierrichtlinien: Erarbeitung einer Auflistung von internen Abkürzungen, Floskeln und Beschreibungen mit med. Kodierern mit Übersetzung in die medizinische Kodierung, um Verlust beim Wissenstransfer zu minimieren.
Direkte Kontakte Klinik – medizinische Kodierung
- Fallbesprechungen: Kliniker und Kodierer besprechen Dokumentationen vor dem Dokumentationsabschluss. Ein regelmässiger Slot / fixierter Termin kann von nachhaltigem Vorteil sein.
- Visitenbegleitung: Kodierer begleiten auf Visiten und weisen auf Optimierungsmöglichkeiten hin[1]
- Teilnahme an Rapporten und (interdisziplinären) Besprechungen: Kodierer nehmen an Rapporten und Besprechungen teil, um auf DRG-relevante Themen hinzuweisen, die in der Dokumentation nicht fehlen sollten
- Schulungen von Kodierern: regelmässige DRG-Schulungen als Bestandteil der klinischen Weiterbildung, Besprechungen von häufig auftauchenden Kodierproblematiken / Beanstandungen. Turnus monatlich / quartalsmässig / halbjährlich. Gewisse Themen wie jährliche Update Schulungen können langfristig fixiert werden.
- Schulungen von Klinikern: die Ärzteschaft gibt fachmedizinische Schulungen für med. Kodierer, um ihr medizinisches Wissen zu stärken und das Leseverständnis zu fördern, um die med. Kodierung zu stärken.
- Definition eines DRG-Verantwortlichen im klinischen Team: ein DRG-Verantwortlicher, Arzt mbF o.ä., kennt sich vertieft mit DRG-Themen aus und dient als konstantes Sprachrohr mit DRG-Wissen und macht seine Teammitglieder auf Wichtiges aufmerksam.
Technische Ansätze
- Pop-Ups / digitale Abfragen bei der Erfassung von Diagnosen, bei der man digital hilfestellt, um Diagnosen zu präzisieren
- Technische Schnittstellen in Austrittsberichte, um Aufwände gesammelt darzustellen, zB Operationen, Transfusionen, VAC-Wechsel, Komplexbehandlungen (IPS / IMC, Ecs, Hämodialysen und Dauer, Pflegekomplex, etc)
- Technische Schnittstellen in Diagnosefeldern, die automatisch Diagnosen in die Diagnoseliste spielen, sobald diese gestellt wurden, zB Adipositas bei der BMI Erfassung, Dekubitus bei der Wunddokumentationserfassung
- Technische Schnittstellen von kodierrelevanten Hinweisen, zB Laborhinweise zu Resistenzen (zB. 3/4MRGN), Verbindungen aus (ärztlichen) Leistungserfassungen (zB Radiologie, Chemotherapie), Medikamentenverordnungen,
- Berechtigungserweiterung in der Bearbeitung der Diagnosefeldern auf hilfestellende Bereiche, damit Diagnosen von Ärzteschaft kontrolliert und freigegeben werden können, zB Vorerfassung Mangelernährung durch Ernährungsberatung, Präzisierung Diabetes-Beschrieb durch Diabetesberatung
Anmerkung zu den Inhalten der Interaktionen:
Es soll darauf geachtet werden, dass keine unnötigen administrativen Aufwände rein DRG-gesteuert integriert werden. Eine sinnvolle und qualitativ hochwertige Medizin soll das lernende Fallpauschalensystem formen, und nicht umgekehrt.
[1] Ressourceneinsätze und Resultate, zB Steigerung von CW, Anzahl Nebendiagnosen, könnten in einer Pilotphase analysiert und/oder relativiert werden.